Mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz sind viele Potenziale verbunden – ein Produktivitätssprung scheint möglich. Allerdings sind zahlreiche Fragen aus Beschäftigtensicht ungeklärt.
In der Arbeitswelt ergeben sich Risiken, wenn Arbeitgeber KI zur Personalverwaltung, Arbeitsorganisation oder als Arbeitsmittel einsetzen. Sie umfassen intransparente Entscheidungen, verschärfte Kontrolle und Gesundheitsgefährdungen. Es kann zu Arbeitsverdichtung, Dequalifizierung und dem Abbau von Arbeitsplätzen kommen. Wenn KI für immer mehr Aufgaben und Entscheidungen genutzt wird, stellt sich die Frage, wie das Menschliche in der Arbeitswelt bewahrt werden kann. Das ist die Kernaufgabe des Arbeitsrechts: Weil Arbeit von Menschen erbracht wird, muss sie an deren Fähigkeiten und Bedürfnisse angepasst werden. Das kann nur durch kollektive Mitsprache der Beschäftigten gelingen.
Die Rechte von Betriebsräten sind deshalb zentral, um den Einsatz von KI auch im Interesse der Beschäftigten zu gestalten. Die KI-Verordnung eröffnet neue Spielräume, Regelungen des hergebrachten Betriebsverfassungsgesetzes sind anwendbar. Es zeigen sich jedoch auch Lücken.
Neue Rechte durch die KI-Verordnung
Die KI-Verordnung ist Produktsicherheitsrecht und enthält nur wenige arbeitsrechtliche Regelungen. Dennoch werden Betriebsräte bei ihrer Umsetzung eine wichtige Rolle spielen. Dies beginnt schon bei der Bestimmung, ob eine Anwendung als KI gilt und wie riskant sie ist. Nach diesen technisch und juristisch anspruchsvollen Fragen richten sich die Pflichten, die der Arbeitgeber beachten muss. Betriebsräte können sie durch externen Sachverstand kontrollieren lassen. Im Konfliktfall können auch Gerichte angerufen werden, wenn die Risikoeinstufung als Vorfrage entschieden werden muss.
Echte Mitbestimmung hat der Betriebsrat bereits bei KI-Technik, die zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle geeignet ist. Ein großes Problem ist bisher, deren genaue Funktionsweise zu verstehen. Hier werden die neuen Transparenzpflichten helfen, welche die KI-Verordnung den Anbietern von Hochrisiko-KI-Systemen gegenüber ihren Kunden auferlegt. Betriebsräte können diese Dokumente einsehen. Sie müssen Informationen u.a. zu Fähigkeiten und Grenzen, Zweck und Genauigkeit sowie Risiken des Systems erteilt werden – bisher oft eine problematische Blackbox.
Beschäftigte benötigen KI-Kompetenz. Daher ist zu begrüßen, dass die KI-Verordnung dazu verpflichtet, dem Personal die Kenntnisse zu vermitteln, damit es rechtskonform handeln, KI-Systeme sachkundig einsetzen und deren Risiken einschätzen kann. Bei der Ausgestaltung der Schulungen steht dem Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht zu, was etwa den Inhalt, Umfang und Teilnehmerkreis betrifft.
Das Risiko intransparenter Entscheidungen wird durch neue Auskunftsansprüche verringert. Die Antworten auf derartige Anfragen helfen Betriebsräten dabei, zu einem menschengerechten Einsatz der Technologie beizutragen.
Beim Arbeitsschutz sieht die KI-Verordnung keine ausdrücklichen Regelungen vor. Der Betriebsrat kann aber seine bestehenden Rechte nutzen und über die menschliche Aufsicht über KI-Systeme mitbestimmen, um Überlastung und psychischen Gefahren zu begegnen.
Schutzlücken und offene Fragen
Die KI-Verordnung bringt somit einige Verbesserungen für Betriebsräte und den Schutz der Beschäftigten. Der gesetzliche Rahmen weist aber dennoch deutliche Lücken auf. So kann der Einsatz von KI dazu führen, dass Tätigkeiten automatisiert und dequalifiziert werden. Das Pensum kann vergrößert, Arbeit schlechter bezahlt und mancher Job abgebaut werden. Ein anschauliches Beispiel liefert die Arbeit von Übersetzern. Um auf sich verändernde Anforderungen zu reagieren, braucht es eine vorausschauende Planung der Arbeitsabläufe, des Personalbedarfs und der Qualifikationen. Bei diesen Fragen hat der Betriebsrat jedoch im Regelfall nur Informations- und Beratungsrechte, die Entscheidung trifft der Arbeitgeber allein. Hier ist eine Aktualisierung und Weiterentwicklung der Mitbestimmung, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, dringend nötig.
Dies gilt auch für Rahmenvereinbarungen zu KI, die Grundsätze zur Risikoeinstufung und daran anknüpfende Verfahren enthalten. Sie gibt es bereits in vielen Unternehmen, wo sie Betriebsrat und Geschäftsführung entlasten. Es fehlt aber bisher an einer rechtlichen Grundlage und einem Initiativrecht für Betriebsräte.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die behördliche Beratung und Aufsicht, insbesondere in Betrieben ohne Betriebsrat. Die Bundesregierung muss nach der KI-Verordnung bis August 2025 die zuständige Behörde benennen, voraussichtlich wird dies die Bundesnetzagentur. Wichtig ist, ihre Arbeit mit den Daten- und Arbeitsschutzbehörden zu verzahnen und Expertise für die Beratung von Beschäftigten und Betriebsräten zu schaffen.
Mitbestimmung weiterentwickeln
Die Bundesregierung möchte Spielräume bei der Umsetzung der KI-Verordnung nutzen. Dies sollte aber nicht nur im Interesse von Wirtschaft und Innovation geschehen. Die Verordnung erlaubt passgenaue und bessere Regelungen zum Arbeitnehmerschutz. Diese Chance sollte Deutschland nutzen. Denn die Mitbestimmung der Beschäftigten ist zentral für eine menschliche Arbeitswelt. Dafür braucht es Arbeitsrecht auf der Höhe der Zeit.
Dieser Text erschien zuerst bei table.briefings am 23.6.2025.
Über den Autor:
Dr. Laurens Brandt ist wissenschaftlicher Referent am Hugo Sinzheimer Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Hans-Böckler-Stiftung, Frankfurt am Main. Dort beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit europäischem Arbeitsrecht.


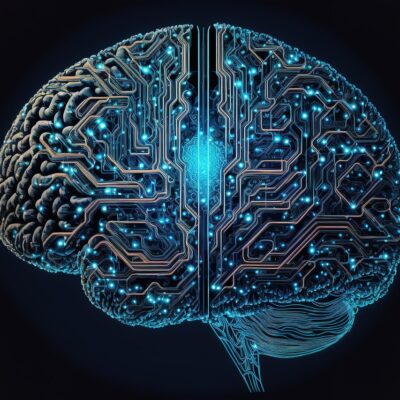
Neueste Kommentare